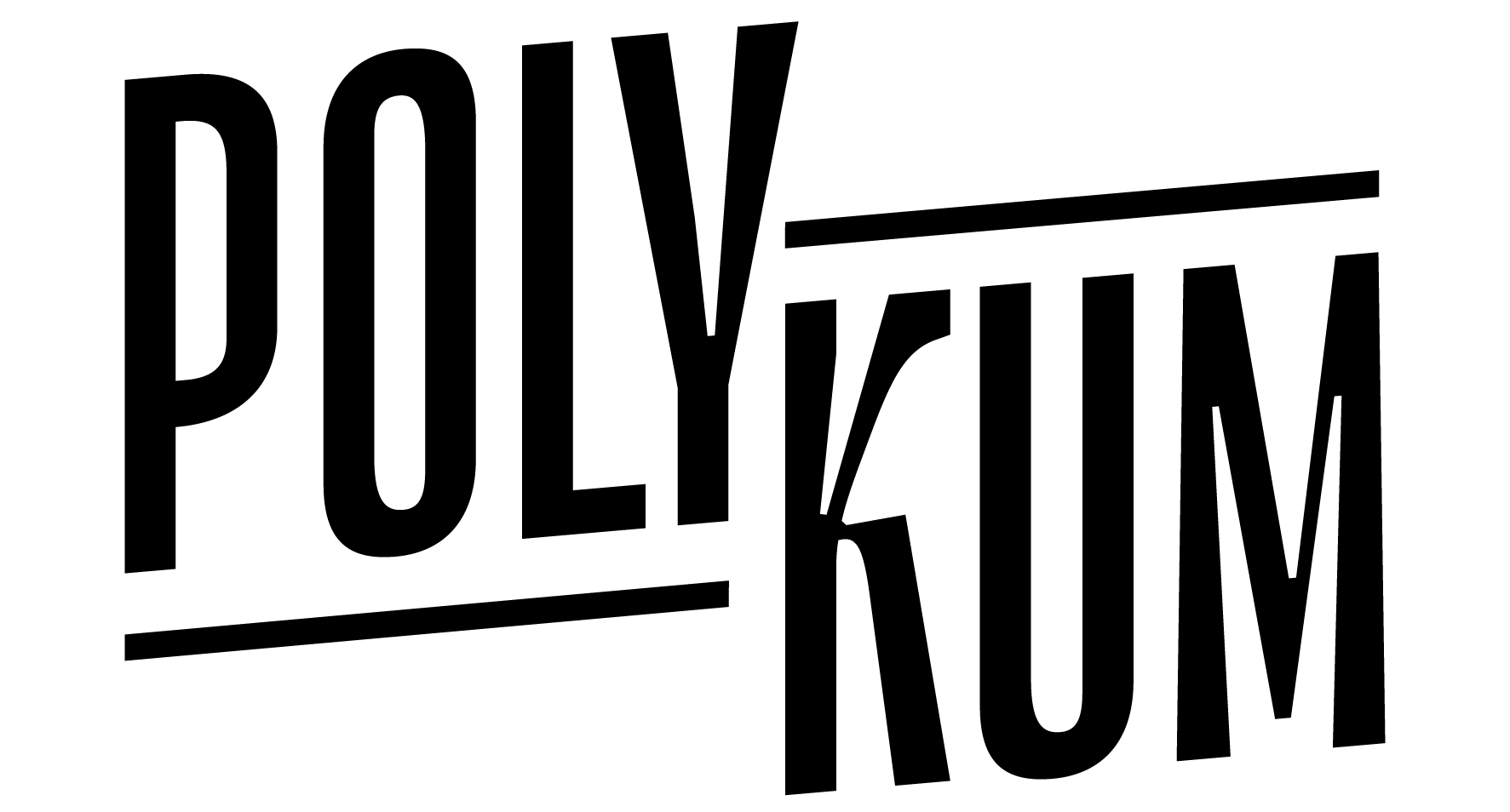Deutschland 1925. Die Weimarer Republik hatte in ihrer noch jungen Geschichte bereits einige ökonomische und politische Krisenmomente wie Hyperinflation und Putschversuche erlebt und begann sich langsam nach dem im Jahr 1924 verabschiedeten Dawes-Plan wirtschaftlich zu erholen. Dem Zusammenbruch des Kaiserreiches der Hohenzollern folgte die Gründung der ersten deutschen Demokratie von 1918, die allen Umständen trotzend einen geeigneten Nährboden für intellektuelle und künstlerische Bewegungen aller Art bot.
Gerade die Mitte der 1920er Jahre brachte eine Vielzahl von Strömungen hervor, die sich mit dem stilbildenden Adjektiv «neu» schmückten und einen kulturellen Aufbruch einleiteten: Neue Frau, Neue Typografie, Neues Sehen, Neues Bauen usw. Doch Weimar standen ihre schlimmsten Krisen noch bevor, die bis zur Absetzung der Demokratie zugunsten der nationalsozialistischen Diktatur im Jahr 1933 reichten.
Die Literatur der späten 1920er Jahre gibt die Atmosphäre der turbulenten Endphase der Weimarer Republik in zahlreichen noch heute lesenswerten Romanen wieder. Literarische Meisterwerke wie Alfred Döblins Berlin Alexanderplatz (1929) und Erich Maria Remarques Kassenschlager Im Westen nichts Neues (1928/29) erschienen in dieser Zeit und prägen unser Bild dieser Epoche bis heute.
Einige Ereignisse der bereits verronnenen 2020er Jahre können ebenfalls als krisenhaft empfunden werden – und Kriege, politische Wirren und einflussreiche digitale Innovationen prägen die kommenden Jahre möglicherweise schon jetzt. In diesem Zuge lädt dieser Artikel zu einer erneuten Beschäftigung mit den reportageartigen Werken der neusachlichen Autoren ein und stellt dafür Erich Kästners (1899–1974) Grossstadtroman Fabian. Die Geschichte eines Moralisten (1931) vor. Die Lektüre fragt nach werkimmanenten Wahrnehmungsmustern und Bewältigungsstrategien von Krisen sowie danach, wie diese uns auch heute in ähnlichen Situationen helfen können.
Literatur am Ende der Zeit
Es lohnt sich, vor der Handlung des Romans die Publikationsgeschichte desselben vorzustellen. Denn Erich Kästner, den meisten Lesenden wohl für sein berühmtes Kinderbuch Emil und die Detektive (1929) bekannt, veröffentlichte mit Fabian eine satirische Speerspitze, die schon bei ihrer Veröffentlichung für Furore sorgte und erst unter dem oben vorgestellten Titel in zensierter Form erscheinen konnte. Die ursprünglich angedachte Version des Romans erschien erst im Jahr 2013 unter dem von Kästner favorisierten Titel Der Gang vor die Hunde im Zürcher Atrium Verlag. Das scheint deshalb erwähnenswert, weil der Verlag von seinem deutsch-jüdischen Gründer Kurt Maschler 1936 vor allem deshalb gegründet wurde, um den unter den Nationalsozialisten verbrannten und verbotenen Roman vom Schweizer Ausland aus publizieren zu können. Doch warum galt Fabian bereits auf inhaltlicher Ebene als dermassen anstössig?
Die Lesenden begleiten den promovierten Literaturwissenschaftler Jakob Fabian bei dessen Streifzügen durch das fiktive Berlin Anfang der 1930er Jahre. Weltwirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit und politische Radikalisierung prägen die Stadt und ihre Bevölkerung spürbar. Der selbsterklärte Moralist begibt sich in neusachlicher Manier auf Beobachtungstour durch das Alltags- und Freizeitleben der Grossstadt und erlebt allerlei Groteskes, das von Heiratsverträgen und Männerbordellen hin zu frei dichtenden Zeitungsmachern und Besuchen in Kabaretten reicht, deren Publikumsraum nur schwer von der eigentlichen Bühne zu unterscheiden ist und die «Topographie der Unmoral» nahtlos vervollständigt.
Der zeitgenössische Trubel verschont den Protagonisten ebenso wenig wie alle anderen sich um ihn herum befindenden Personen. Als Fabian das unvorhergesehene Glück der Liebe in Form einer zufälligen Bekanntschaft vor die Füsse fällt, verliert der Literat seinen Job als Propagandist in einer Zigarettenfirma im Zuge von Rationalisierungsmassnahmen. Daraufhin wendet sich die aufstrebende Schauspielerin Cornelia Battenberg von ihm ab und schliesst sich zugunsten ihrer ökonomischen Verhältnisse und besseren Karrierechancen einem berühmten Filmdirektor an. Fabian verliert seinen Optimismus und die durch Cornelia gewonnenen Lebensziele ebenso schnell, wie er sie gefasst hat, und wird von einer tiefgreifenden Lethargie ergriffen.
Krise als Totalitätserfahrung
Die Figuren des Romans sind sich einig: Die Krise sitzt tief, ist eine schichtübergreifende und ortsunabhängige Erfahrung und besetzt jeden noch so kleinen Handlungsraum im Leben der Menschen. Misstrauen, Skepsis und Instabilität prägen den Alltag und geben kaum Aussicht auf Besserung. Das literarische Motiv der zyklischen Zeit wird immer wieder bewusst eingesetzt, um die Ängste der Figuren vor einem erneuten Krieg und den einhergehenden Gräueltaten hervorzurufen. Fabian sucht den Ursprung der Krise im moralischen Werteverfall, ohne sich dabei selbst als Positivbeispiel herausnehmen zu wollen.
Hinsichtlich der Lösung des Problems unterscheiden sich die Ansichten enorm. Während Fabians bester Freund Stephan Labude, ein aus dem Wirtschaftsbürgertum stammender Akademiker, die Gesellschaft durch ein verändertes wirtschaftliches System von oben herab zu verbessern sucht – ein Verweis auf den englischen Fabianismus nicht ohne Augenzwinkern – scheint sich Fabian noch mit der Eignung der Menschen zur Vernunft zu beschäftigen.
Zufällige Bekanntschaften geben ihm auf seinen Reisen immer wieder Hoffnung und gelten als vorbildlich in einer unmoralischen Welt. Hier der Erfinder einer Textilmaschine, die Abermillionen Mark einspülen kann, aber im Gegenzug tausende Arbeitsplätze vernichtet und den Erfinder samt Bauplänen aus moralischen Gründen zur Flucht zwingt. Dort das Mädchen, welches das von Fabian erhaltene Geld nach dem Beischlaf heimlich in dessen Jacke zurücksteckt, um der Zwischenmenschlichkeit jeden Warencharakter zu entziehen.
Aber dennoch!
«Der Moralist pflegt seiner Epoche keinen Spiegel, sondern einen Zerrspiegel vorzuhalten. Die Karikatur, ein legitimes Kunstmittel, ist das Äusserste, was er vermag. Wenn auch das nicht mehr hilft, dann hilft überhaupt nichts mehr. Dass überhaupt nichts hilft, ist keine Seltenheit. Eine Seltenheit wäre es vielmehr, wenn das den Moralisten entmutigte. Sein angestammter Platz ist und bleibt der verlorene Posten. Ihn füllt er, so gut er kann, aus. Sein Wahlspruch heisst: Dennoch!»
Im Vorwort zur Neuauflage des Romans, die gleich nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1946 erscheinen sollte, kommentiert der Autor sein Werk anlässlich der nicht weniger intensiv geführten Diskussionen desselben, wobei die Person Kästners mit seiner Hauptfigur zu verschmelzen scheint. Die Aussagen betreffen unter anderem das ebenso eindeutige wie irritierende Ende des Romans.
Während die einen monieren, Kästner sei kein besserer Schluss als der groteske Tod eines Nichtschwimmers im Fluss bei einer versuchten Rettungstat eingefallen, soll hier eine andere, ermutigende Sichtweise geäussert werden.
Fabians Tod ist der von Kästner bewusst überspitzt dargestellte Ausdruck einer nicht zu brechenden Überzeugung: Selbst im Angesicht der totalen Aussichtslosigkeit lohnt es sich, für seine Ideale einzustehen und auch die kleinste Möglichkeit zur Verbesserung der Situation zu nutzen. Denn von anderen wahrgenommen, kann sie als Vorbild dienen, Hoffnung spenden und Grosses entflammen. Vorbilder bedarf es jederzeit, unabhängig jeden politischen Systems.
Colin Hoffmann