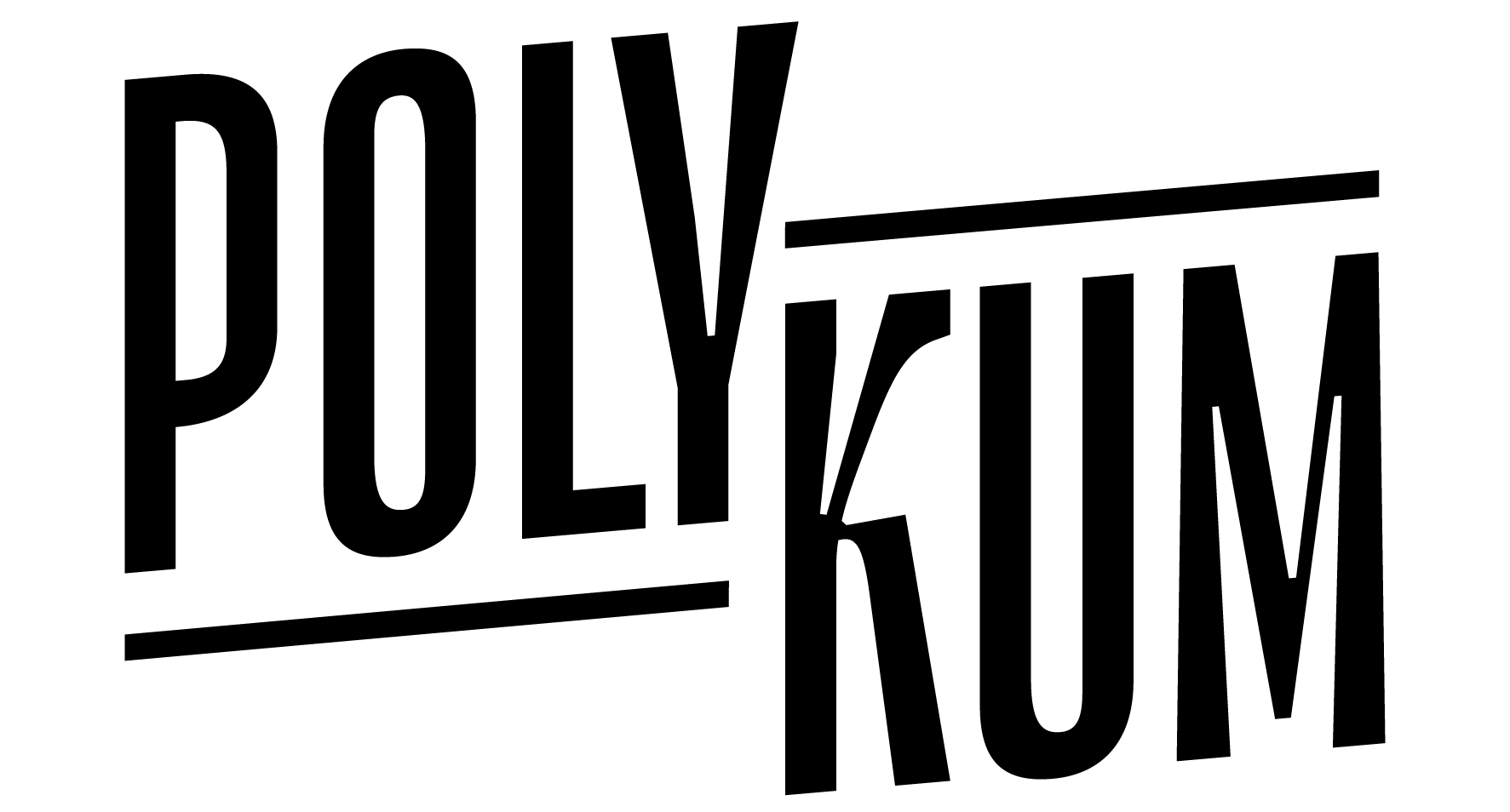Wie kann man die Intelligenz von Tieren messen? Forschende haben für dieses schwierige Problem verschiedene Tests entwickelt. Einer davon ist der Spiegeltest, der untersucht, ob ein Tier sein eigenes Spiegelbild erkennt. Dazu wird ihm eine Farbmarkierung an einer aus der eigenen Perspektive nicht sichtbaren Körperstelle angebracht. Versucht es nach dem Blick in den Spiegel, diese zu entfernen, ist das ein Zeichen, dass es erkannt hat, dass es sein eigenes Abbild vor sich hat. Die meisten Tiere, darunter Hunde oder Katzen, bestehen den Test nicht. Sie reagieren entweder aggressiv auf das Bild im Spiegel oder versuchen, mit ihm zu spielen, weil sie denken, einen Artgenossen vor sich zu sehen. Menschliche Babys schaffen den Spiegeltest erst im Alter von etwa 15 bis 18 Monaten. Und nur wenige Tierarten erkennen sich selbst. Dies sind neben Bonobos, Schimpansen, Gorillas und Orang-Utans auch Asiatische Elefanten, Delfine und Orcas. Der einzige Vogel, der bisher bestanden hat, ist die Elster. Unter den Fischen gibt es Hinweise, dass Mantarochen ihr Spiegelbild ebenfalls erkennen.
Ob der Spiegeltest eindeutig zeigt, ob ein Tier eine Vorstellung eines «Selbst» hat, ist umstritten. Wenn sich Tiere mehr an Gerüchen, Lauten oder Berührungen orientieren als an optischen Eindrücken, ist das Nicht-Bestehen des Spiegeltests nicht unbedingt aussagekräftig. Oder vielleicht interessiert es manche Tiere einfach nicht, wenn sich eine Farbmarkierung auf ihrem Körper befindet. Zudem gibt es bei der Frage nach einem Ich-Bewusstsein möglicherweise nicht nur ein klares Ja oder Nein, sondern auch Zwischenstufen.
Eine Frage der Grösse?
Um tierische Intelligenz systematisch zu untersuchen, hat ein internationales Forschungsteam unter der Leitung von MacLean 2014 zwei neue Prüfmethoden entwickelt, um die Impulskontrolle von Tieren zu erforschen. Dieser kommt bei Entscheidungsprozessen eine wichtige Rolle zu, weshalb sie eng mit der Intelligenz verknüpft ist. Beim ersten Test hat das Tier zwei Behälter vor sich, wobei sich die Belohnung immer unter dem einen Behälter versteckt. Dann sieht es, wie das Futter beim nächsten Durchgang unter den anderen Behälter verschoben wird. Um den Test zu bestehen, müssen die Tiere den Impuls unterdrücken können, wie zuvor unter dem ersten Behälter nachzusehen. Bei der zweiten Prüfmethode befindet sich Futter in der Mitte einer durchsichtigen Röhre. Die intelligenteren Tiere können den Impuls unterdrücken, zu versuchen, auf direktem Weg durch die Röhrenwand hindurch nach dem Futter zu greifen und stecken die Hand stattdessen sofort seitlich hinein. Zuvor wurde angenommen, dass das entscheidende Mass für die Intelligenz von Tieren die Hirnmasse relativ zum Körpergewicht ist. Die Ergebnisse dieser Studie deuten jedoch eher darauf hin, dass die absolute Hirnmasse ausschlaggebend ist. Bei nahe verwandten Arten schnitten zudem eher diejenigen gut ab, die sich von einer breiten Futterpalette ernähren, weshalb dies einer der Faktoren zu sein scheint, die zur Ausbildung einer höheren Kognition führen.
Mit acht Armen und neun Gehirnen
Lange Zeit konzentrierte sich die Suche nach den intelligentesten Tieren auf Wirbel- und insbesondere Säugetiere. Doch auch im Meer findet sich eine Spezies, die zu Erstaunlichem fähig ist.
Das Nervensystem von Kraken ist völlig anders aufgebaut als jenes von Wirbeltieren. Nur etwa ein Drittel aller Neuronen befindet sich im Kopf, der Rest ist über die acht Arme verteilt, weshalb sie quasi über neun Gehirne verfügen. Obwohl man sie lange Zeit für primitiv hielt, zeigen die Weichtiere mit den acht Tentakeln bemerkenswertes Verhalten. Es wurde beobachtet, wie Kraken halbe Kokosnussschalen aus dem Boden ausgraben und säubern, sich hineinsetzen und anschliessend in der Umgebung nach einer zweiten Schalenhälfte suchen. Ist diese gefunden, ziehen sie die beiden Schalenhälften mit ihren Saugnäpfen zusammen und sind im Innern gut geschützt. Andere Kraken sammeln in ihrer Umgebung Steine, um den Eingang ihrer Versteckhöhle so zu verkleinern, dass sie gerade noch hindurchpassen.
Beide Verhaltensweisen zeugen von geplantem, absichtsvollem Handeln. Die Kopffüsser verfügen zudem über ein räumliches Gedächtnis und können sich ihre Umgebung einprägen. Manche in Gefangenschaft gehaltene Kraken zeigen spielerisches Verhalten, wenn sie eine Plastikdose gezielt in den Wasserstrahl der Aquariumpumpe werfen, von wo sie wieder zurückgetrieben wird und sich das Spiel wiederholt. Sie sind sehr lernfähig und können nach wenigen Tagen Üben einen Schraubdeckel öffnen, um an eine Futterbelohnung heranzukommen. Der Spieltrieb und die Fähigkeit zu lernen ist für Kraken überlebenswichtig: Als Jungtiere werden sie von der Strömung oft an neue Orte getragen, wodurch sie sich in verschiedensten Lebensräumen zurechtfinden müssen. Die Einzelgänger können sich nichts von anderen Artgenossen abschauen, sondern müssen durch eigenes, neugieriges Ausprobieren lernen. Sie scheinen auch über verschiedene Persönlichkeiten zu verfügen. So sind manche eher schüchtern, andere neugierig oder draufgängerisch.
Intelligenz der Masse
Schwärme von Fischen oder Vögeln weichen agil Räubern aus oder steuern Futterplätze an. Beobachtet man sie dabei, ist kaum zu glauben, dass es keine zentrale Kontrollinstanz gibt, die dieses Verhalten koordiniert. Handelt es sich hier um sogenannte Schwarmintelligenz? Das einzelne Tier hat keinen Überblick über die Bewegung oder Grösse des Schwarms. Das faszinierende Verhalten beruht auf simplen Regeln, die jedes Tier befolgt: Bleibe nahe bei der Gruppe, vermeide Zusammenstösse und bewege dich in die gleiche Richtung wie die Artgenossen um dich herum. Klingt nicht wirklich nach Intelligenz. Und doch ist der Schwarm als Ganzes in der Lage, Probleme wie das Abwehren von Feinden oder das Finden von Futter- oder Schlafplätzen zu meistern.
Staatenbildende Insekten wie Bienen treiben das Prinzip der Intelligenz der Masse auf eine noch ausgefeiltere Stufe. Bienen haben eine strenge Arbeitsteilung, die mit den verschiedenen Organen eines Organismus vergleichbar ist, weshalb manche Forschende von einem «Superorganismus» sprechen. Ein Bienenvolk kann Optimierungsprobleme lösen, die über das Überleben des Staates entscheiden: Wenn eine neue Königin schlüpft, verlässt die alte Königin mit einem Grossteil der Bienen das Nest. Sie müssen einen neuen Nistplatz finden. Kundschafterinnen schwärmen aus und teilen bei ihrer Rückkehr mit einem Schwänzeltanz mit, wenn sie einen passenden Ort ausgemacht haben. Andere Kundschafterinnen folgen dieser Wegbeschreibung und wenn sie den Platz ebenfalls für geeignet halten, stimmen sie in den Tanz mit ein. Nach und nach tanzen immer mehr Bienen für die vielversprechendsten Orte. Nahe gelegene Optionen sind im Vorteil, weil die Kundschafterinnen von dort schneller zurückkehren und so nach kurzer Zeit mehr Bienen für diese tanzen. Schliesslich gibt es nur noch einen Tanz für den besten Nistplatz und der Schwarm bricht zu diesem auf. Das Kollektiv hat die optimale Lösung gefunden, ohne dass es eine zentrale Entscheidungsstelle gibt. Eine einzelne Biene mit ihrem winzigen Gehirn wäre zu so einer Leistung nicht fähig. Erst die Gruppe macht es möglich.
Der Erfolg der Dummen
Die Evolution führt nicht unbedingt zu immer intelligenteren Lebewesen. Intelligenter zu werden ist im Gegenteil eher ein Sonderweg der Evolution, der nur unter äusserem Druck gegangen wird, wie etwa im Fall der Kraken. Lebewesen müssen nicht möglichst klug sein, sondern nur gerade klug genug. Denn ein Gehirn kostet viel Energie. So kann es im Streben nach dem Optimum Sinn machen, nicht klüger, sondern dümmer zu werden. Dies ist bei Muscheln passiert, deren Vorfahren sich über den Meeresboden bewegten, um aktiv nach Nahrung zu suchen. Die heutigen Muscheln filtern das Wasser nach Nährstoffen, was deutlich weniger kognitive Leistung erfordert. Deshalb hat sich ihr Gehirn bis auf wenige Nervenknoten zurückgebildet.

Ein Gürteltier auf Nahrungssuche
Auch dem Gürteltier bringt ein kleines Hirn Vorteile. Unter den Säugetieren hat es eines der kleinsten Gehirne relativ zum Körpergewicht. Trotzdem ist es seit über 60 Millionen Jahren erfolgreich. Und das kleine Gehirn bietet Vorteile: Es benötigt weniger Sauerstoff. So können Gürteltiere bis zu sechs Minuten am Stück in der Erde nach Insekten wühlen, ohne Atem holen zu müssen. Doch die beschränkten kognitiven Fähigkeiten haben auch ihren Preis. So haben Gürteltiere simple, immer gleiche Verhaltensweisen und können sich nicht an ändernde Umweltbedingungen anpassen. Wenn sie erschrecken, springen sie in die Höhe. Dies schlägt Angreifer wie Kojoten in die Flucht. Doch beim Überqueren von Strassen führt diese Reaktion zum Tod. Sich nicht in kurzer Zeit an ändernde Umweltbedingungen anpassen zu können, ist die Kehrseite eingeschränkter kognitiver Fähigkeiten.
Sabrina Strub, 25, MSc Bauingenieurwissenschaften, wüsste gerne, was Menschenaffen im Zoo von den Besucher*innen denken. Wer beobachtet hier wen und wer ist zu wessen Unterhaltung hier?
Bildlegenden:
Ein Gürteltier auf Nahrungssuche
In einer Muschel hat ein kleiner Krake ein Versteck gefunden
Eine Bienenkönigin umgeben von ihrem Volk