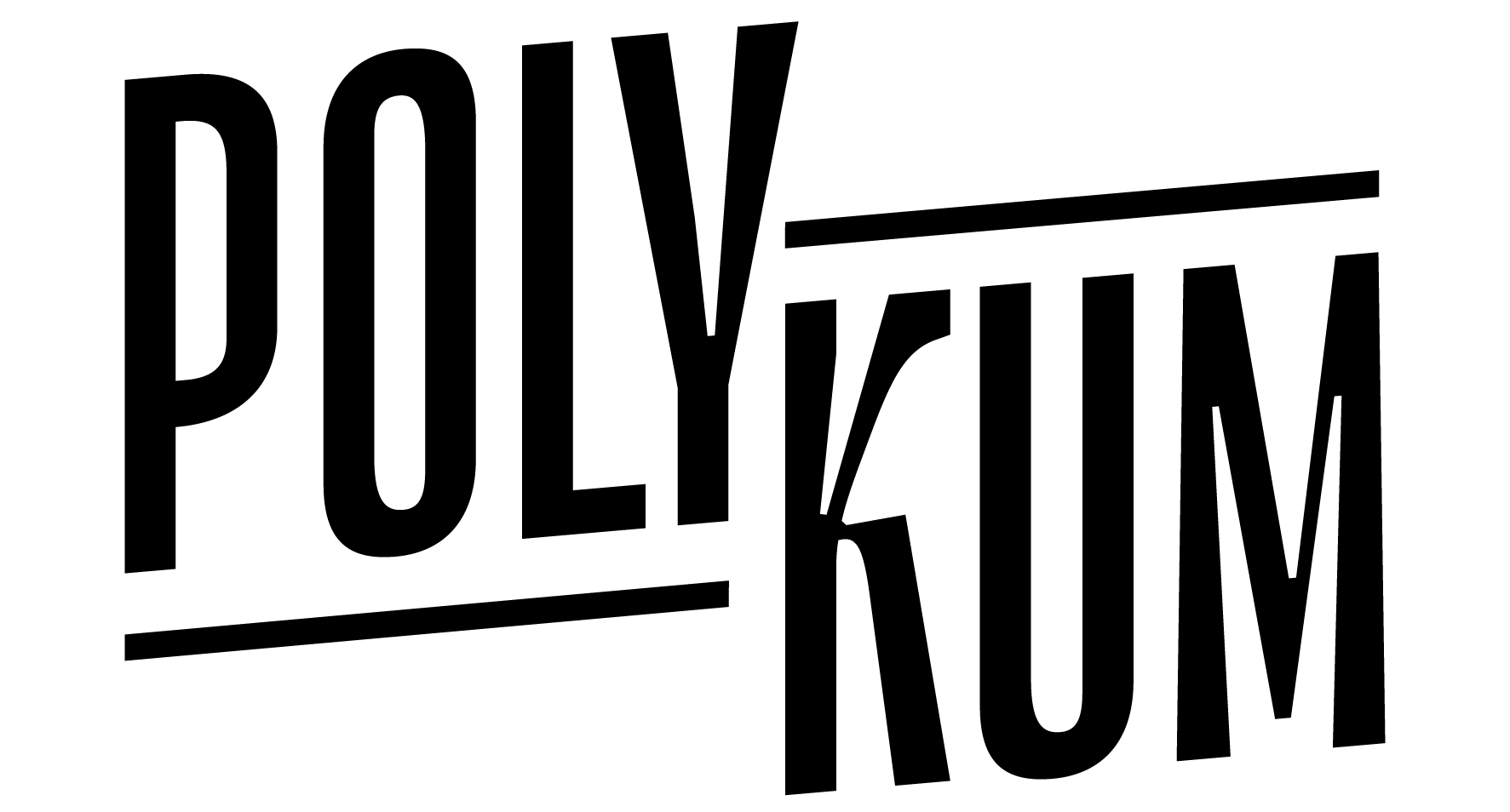Warum das Universum aufhören würde zu existieren, wenn es die Wissenschaft nicht gäbe und über den schwachen Zusammenhang zwischen Paul Feyerabend und dem niederländischen Barock.
Wer in nächster Zeit wieder vergebens in der Bibliothek nach einem freien Arbeitsplatz suchen sollte, dem sei der Saal der niederländischen Meister im Kunsthaus wärmstens ans Herz gelegt. Ungeachtet der Tageszeit verweilt man dort zumeist nicht nur in Ruhe, sondern in fast absoluter Isolation. Dies soll indes nicht Anlass zum Kulturpessismus geben, erfreut sich doch das Kunsthaus stetig wachsender Besucherzahlen. Das Interesse an Kunst war immer schon ungleich verteilt und ist es zunehmend so. Das eigentliche Überraschende ist viel eher, dass sich überhaupt jemand für ein barockes Stillleben interessieren könnte: Um eine geschälte Zitrone zu sehen, muss man nicht ins Museum gehen. Das Stillleben ist zu realistisch, um interessant zu sein.
Kunst als Werk der Natur
Dieser Vorwurf ist doppelt ironisch: Nicht nur weil von derselben Fraktion zumeist der gegenteilige Vorwurf über zeitgenössische Kunst zu hören ist – nämlich der unverständlich zu sein –, sondern auch weil die niederländischen Meister ihre Stillleben fast nie direkt nach der Realität gemalt haben. Skizzen und Vorstudien dienten im Atelier beinahe immer als Vorlage, was ab und an dazu geführt hat, dass in einer Komposition Blüten zusammen abgebildet sind, die biologisch unmöglich zusammen blühen können.
Die Maler des niederländischen Barock, zumindest die Guten, geben nicht einfach nur die Wirklichkeit wieder. Vielmehr findet die Natur im Gemälde erst ihre Verwirklichung. Zudem stellt das Stillleben das Natürliche in eine künstliche Umgebung: Die Blume muss stets durch die Vase umschlossen sein. Künstlich ist aber auch die Komposition selbst. Die dargestellten Gegenstände hätten nie auf natürlichem Wege zueinander gefunden. Erst der Wille des Malers hat sie zu dieser Komposition gedrängt. Doch das oberste Ziel des Stilllebens bleibt die photorealistische Darstellung seines Sujets. So willig sich die Dinge auch zusammenfügen lassen, will doch ein jedes naturgetreu abgebildet sein.
Frohen Feyerabend
Nicht anders sei es mit den Wissenschaften, behauptet der Philosoph Paul Feyerabend (1924 – 1994): Forschung ist, wenn überhaupt, nicht realistisch genug. Eine wissenschaftliche Theorie ist nicht bloss eine Abstraktion aus empirischen Daten. Jedes Datum entsteht erst durch den Eingriff des Wissenschaftlers in die Realität. Keine Beobachtung ohne Beobachtenden. Selbst eine einfache Messung, wie die des Wägens, wächst in der modernen Forschung zu einem hochkomplexen und in der echten Welt nicht zu wiederholenden Prozess heran. Am extremen Ende dieser Evolution benötigt eine einzelne Messung den ganzen CERN. Aber was wir während einer Teilchenkollision beobachten, ist nach Feyerabend kein natürliches Geschehnis mehr: Ohne uns Menschen hätte es diesen Aufprall nie gegeben. Die Annahme dass sich das Universum auch sonst wie im CERN verhält, heisst so viel Vertrauen in die Wissenschaft zu setzen, wie ein Biologe in die Malerei, wenn er seine Feldstudie lieber vor einem Stillleben als in der freien Natur vornimmt.
Gemäss Feyerabend, dessen Namen die meisten im Student-Village eher vom Amazon-Pakete Bestellen kennen, vereinen wir Wissenschaftler zwei Rollen zugleich in uns: Einerseits bilden wir ausgehend von einer Menge an Beobachtungen unsere Theorien, und andererseits bestimmen wir selbst, welche Menge wir durch die Theorien zu erklären suchen. Wie der Maler seine Blüten, so sammelt auch die Forscherin ihre Beobachtungen zusammen, bis sie sich zu einem schönen Strauss formen lassen.
Natur als Werk der Kunst
Das gesamte Universum vom Virus bis zur Galaxie ist ein solcher Artefakt, geschaffen über Generationen von Wissenschafts-Künstlern aus einer halb willigen halb widerspenstigen Materie, die wir Wirklichkeit nennen. Feyerabend, der vor allem durch sein 1975 erschienenes Buch Wider den Methodenzwang bekannt wurde, sieht hierin die grosse Hybris der Wissenschaften. Niemand von uns hat den Urknall miterlebt. Gäbe es die Wissenschaft nicht, würde heute kein Mensch an eine derart absurde Theorie glauben. Wenn die Menge an zu erklärenden Daten nur lautet {«Die Welt existiert.», «Es gibt verschiedene Materie.», «Es gibt uns Menschen.», …}, dann ist die Theorie eines schöpferischen Gottes genauso – wenn nicht sogar mehr überzeugend. Erst wenn wir den Datensatz hin zu kosmischer Strahlung, einem expandierenden Universum und Gravitationswellen umdefinieren, gewinnt unsere wissenschaftliche Theorie die Oberhand. Für Feyerabend ist dies tautologisch: Natürlich wird die wissenschaftliche Theorie gewinnen, wenn wir nur Wissenschaftler definieren lassen, was diese Theorie zu erklären hat.
Dieser sich ständig ändernde Satz an zu erklärenden Beobachtungen ist der Grund, warum es in den Wissenschaften nie eine sondern unzählige Methoden und Theorien der Erkenntnis gibt. Forschung ist – wie Malen – eine Frage des Stils. Aber Feyerabend ist kein Relativist: Genauso wenig wie der niederländische Barock einen Hummer mit acht Beinen malen könnte, kann eine Wissenschaftlerin eine Theorie formulieren, die im Widerspruch mit der Realität steht. Wofür Feyerabend plädiert, ist schlicht die Bescheidenheit, als Forschende einzugestehen, dass unsere besten Theorien zwar gut darin sind Flugzeuge zu bauen, aber nicht den Schmerz einer trauernden Mutter trösten oder die Frage zu beantworten, warum es Bewusstsein im Universum gibt. Die meisten wissenschaftlichen Theorien jedenfalls haben eine sehr viel kürzere Halbwertszeit als jene Blumen auf den Stillleben des niederländischen Barock. Aber zumindest garantiert uns der zweite Hauptsatz noch immer, dass auch diese sich irgendwann in nichts auflösen werden.