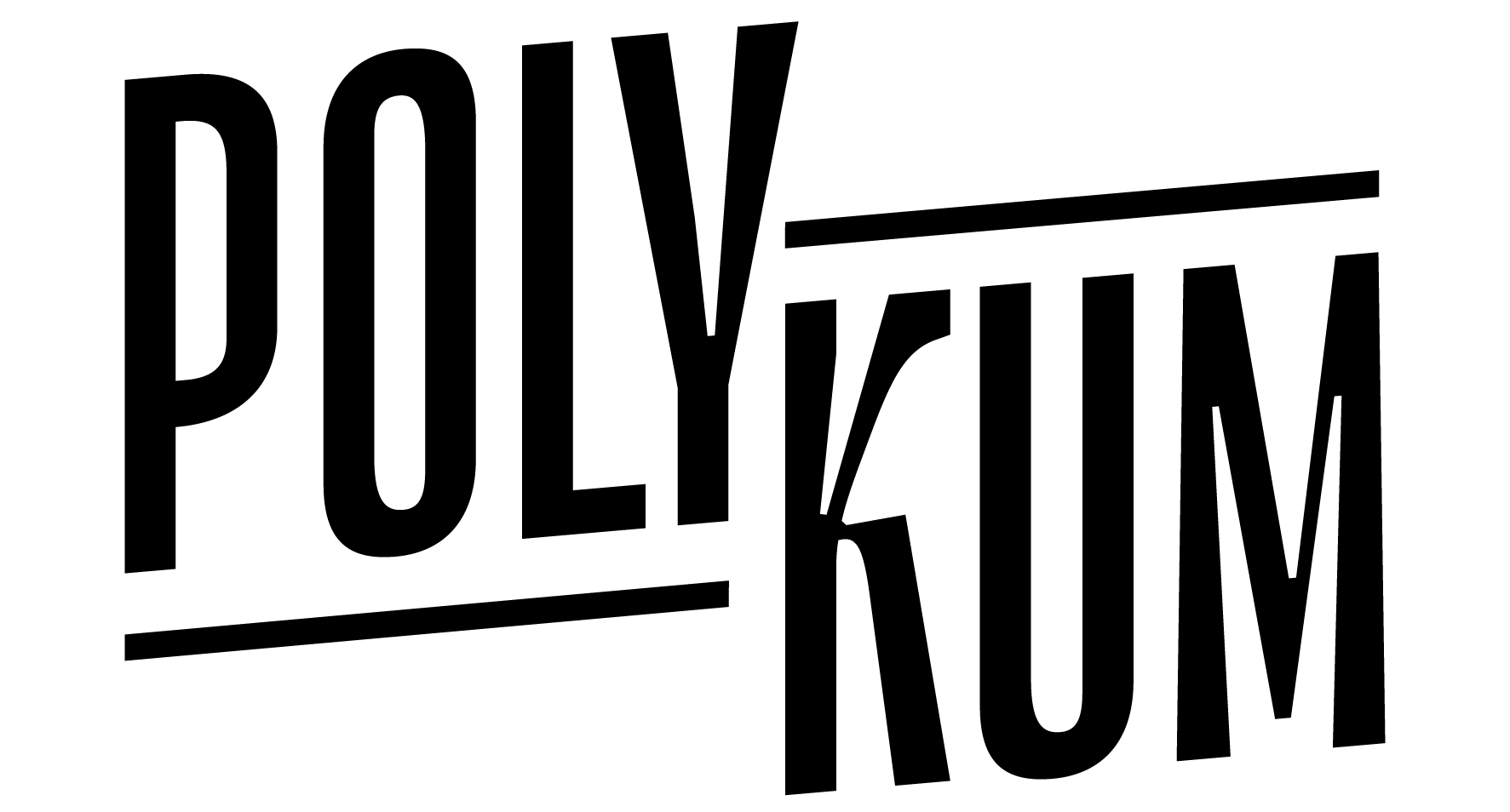Die modernen Naturwissenschaften beanspruchen, uns die Welt und die Ordnung der darin enthaltenen Dinge verständlich zu machen und dadurch zur Verbesserung der menschlichen Existenz beizutragen. Doch selbst an der ETH Zürich blieb diese Ansicht nicht ohne Kritik.
Ihrem Namen, Ruf und ihrer Geschichte nach verkörpert die ETH Zürich eine Institution, die sich der systematischen Erforschung der Naturphänomene und der technischen Manipulation unserer Umwelt verschrieben hat. Intuitiv verbindet man ein solches Unterfangen mit einer No-Bullshit- und Common-Sense-Perspektive auf die Fragen der Wissenschaftsphilosophie. Zynische Philosoph*innen in Frankreich mögen behaupten, Wissenschaft sei nur eine menschliche Aktivität neben anderen, Objekte wie Quanten oder Wellen seien Konstrukte, und die wissenschaftliche Methode bringe uns nicht näher an die Realität. Doch diese wissenschaftskritischen Intellektuellen bleiben Randnotizen in der Erfolgsgeschichte der Wissenschaften, die uns in die Lüfte und ins Weltall brachten, tödliche Krankheiten zu vernachlässigbaren Ärgernissen machten und kontinuierlich an der Lösung menschlicher Probleme arbeiten. Wer die Wahrheitstreue der Wissenschaft bezweifelt, so die vorherrschende Meinung, hasst entweder die Wissenschaften und den Fortschritt oder versteht sie nicht.
Wissenschaftskritik an der ETH?
Es verwundert wenig, dass die ETH ihren Philosophie-Lehrstuhl mit Personen besetzt, die die Wissenschaften sowohl kennen als auch schätzen. Umso erstaunlicher ist, dass der vielleicht berühmteste Inhaber dieses Lehrstuhls, Paul Feyerabend, offen die Adäquatheit der wissenschaftlichen Methode, das Fortschrittsnarrativ der Wissenschaftsgeschichte und selbst den Common-Sense-Realismus in Frage gestellt hat. Feyerabend lehrte von 1980-1990 abwechselnd ein Semester in Berkeley und in Zürich. In Werken wie «Erkenntnis für freie Menschen» und in seinen gut besuchten Vorlesungen sprach sich Feyerabend gegen die Vorstellung aus, dass wissenschaftliche Theorien die Ordnung der Wirklichkeit akkurat abbilden würden oder überhaupt abbilden könnten.
Pluralistische Wissenschaft
Feyerabends Absicht war keineswegs, die Wissenschaft zu diskreditieren. Im Gegenteil: Er wollte die mythische Vorstellung des wissenschaftlichen Realismus aufgeben, um bessere Wissenschaft zu ermöglichen. Statt danach zu streben, die Ordnung der Dinge und die Gesetze der Natur «einzufangen», sollten wir erkennen, dass wissenschaftliche Theorien von unseren (historisch gewachsenen) Bedürfnissen geprägt sind und ihre Wahrheit nie über jeden Zweifel erhaben sein wird. Und das muss sie auch nicht sein! Ein pluralistisches Verständnis unterschiedlicher Zugänge, Methoden und Theorien ist notwendig, um die Welt möglichst unvoreingenommen zu erforschen.
Historische Wurzeln moderner Probleme
In seinem Streben nach einer offenen und pragmatischen Wissenschaftskonzeption kritisierte Feyerabend besonders in seinen ETH-Vorlesungen das gängige Narrativ der Wissenschaftsgeschichte, wonach die Wissenschaften die Zahl menschlicher Probleme stetig reduziert, das Dasein verbessert haben und weiterhin verbessern werden. Die 2023 von Michael Hampe und Michael Hagner editierten Vorlesungsaufzeichnungen erschienen unter dem Titel «Historische Wurzeln moderner Probleme», worin Feyerabend seine Ansicht skizziert, dass wissenschaftliche Lösungen oft den Samen für spätere Probleme gesät hätten. Diese Thesen untermauerte er mit konkreten Fallbeispielen statt rein abstrakter Argumentation. Das bei Suhrkamp erschienene Buch erlaubt einen Einblick in Feyerabends exzentrischen Charakter und Vorlesungsstil und erlaubt, eine erweiterte und umfangreichere Perspektive auf die moderne Wissenschaft zu erlangen.